Text
Die Lehrer gehen online
#lehrer #lehrerin #lehrerleben #lehreralltag #lehrerrealität #lehrerzimmer #lehrerundschüler #lehrertasche #lehrerdasein #lehrerkalender …
Hashtags setzten kann ich, dass denken sich mittlerweile auch viele Lehrkräfte.
Ich bin Jahrgang 1995 und damit einer der letzten, die nicht ihr ganzes Leben auf sozialen Netzwerken dokumentiert sehen. Oft beginnen schon die Eltern Fotos von ihren Kleinen zu posten. Diese Kleinen werden dann älter und bald schon können sie das posten auf ihrem eigenen Profil übernehmen. Die schönsten Momente, die neueste Kleidung, die erste große Liebe, die emotionale Teenagerphase, die zweite Liebe, Verlobung, Hochzeit, Kind. Bilder von den Kleinen werden gepostet. Ein Kreislauf der vielleicht erst mit dem Tod und dem Streit um das digitale Erbe endet.
Wie sollten sich Lehrer dieser Entwicklung gegenüber verhalten?
Ich persönlich habe Profile auf verschiedenen Plattformen dazu gehören Facebook, Instagram und Twitter. Muss mir aber eingestehen, dass ich mich besonders bei Twitter nicht gut auskenne und Facebook nur noch selten nutze. Seit mir bewusst ist, dass ich Lehrerin werden möchte, achte ich sehr genau darauf, was ich ins Netz stelle bzw. was andere von mir posten. Immer häufiger erlebe ich Lehrkräfte die sich entweder unsicher mit der Präsentation der eigenen Person auf sozialen Netzwerken sind oder ihr Leben sehr offen mit den SuS teilen. Ich weiß nicht ob ich konservativ bin oder es schlichtweg an der deutschen Kultur lieg, dass ich sehr großen Respekt vor dem Kontakt mit SuS in sozialen Netzwerken habe. Mein Ziel ist für mich einen Weg zu finden, mich als Person des privaten Lebens und als Lehrperson angemessen in sozialen Netzwerken zu präsentieren. Bei der Suche nach „meinem richtigen Weg“ bin ich auf Philippe Wampfler gestoßen.
Philippe Wampfler, ein Lehrer, Fachdidaktiker, Kulturwissenschaftler und Experte für Lernen mit neuen Medien, stellt für mich einen Vorreiter in diesem Thema dar. Unter https://schulesocialmedia.com/2012/03/23/wie-sollen-lehrerinnen-und-lehrer-auf-social-media-im-internet-prasent-sein/ erklärt er wie Lehrerinnen und Lehrer auf Social Media / im Internet präsent sein sollten. Als Fazit können seine Social Media-Guidelines für Lehrpersonen gesehen werden.
Tue nichts Dummes!
Man ist im Internet nie nur Privatperson, sondern wird als auch Lehrperson wahrgenommen.
Achte auf deinen Ruf und auf den deiner Schule.
Tue nichts, was Zweifel an deiner Qualifikation für den Lehrberuf und an deiner Fairness gegenüber deinen Schülerinnen und Schüler auslösen könnte.
Zeige Fingerspitzengefühl bei politischen, religiösen und anderen heiklen Themen.
Schreibe nichts, von dem du nicht willst, dass es auch morgen oder in einigen Jahren noch auf dem Netz zu finden sein wird.
Soziale Netzwerke sind Werkzeuge, keine Spielzeuge.
Interagiere mit Schülerinnen, Schülern und anderen Lehrpersonen.
Bleibe höflich.
Kümmere dich um deine Privatsphäreneinstellungen.
Halte dich auch im Netz an Gesetze – insbesondere ans Urheberrecht.
Diese Social Media-Guidelines kann ich für mich ohne Probleme übernehmen. Doch alleine durch Philippe Wampfler werde ich mein Ziel nicht erreichen, wie geht ihr mit dem Thema um? Habt ihr noch Tipps für mich?
Ich freue mich über euere Kommentare.

Euerer becomeateacherlove
3 notes
·
View notes
Text
Germany´s next Rolemodel?

Wir kennen sie wohl alle, die tränenreichste emotionsgeladene Castingshow auf Prosieben. Bisher geleitet von unserem wunderschönen Victoria Secret Engel Heidi Klum. Immer das selbe, tausende von Mädchen stellen sich vor, der erste Eindruck entscheidet, dass eine kleinere Menge brauchbar ist und dann beginnt der Kampf. Eine Challenge jagt die nächste, Tränen werden vergossen und Alibi Freundschaften geschlossen, könnte ja sein, dass mir meine Verbündete helfen kann. Dann die großen Aufträge, Venus und letzten Endes das Cover der Cosmopolitan. Der, so wird es zumindest dargestellt, Traum jeden Mädchens.
Damit hätten wir den Salat. Der Traum jeden Mädchens ist es also auf dem Cover einer Zeitschrift für Mode, Beauty, Liebe, Erfolg, Lifestyle und Horoskope zu sein? Nein, um der Show nicht ihren Wert zu nehmen: Der Traum jeden Mädchens ist es von Heidi Klum so zurechtgestutzt zu werden, dass sie die Ehre erhalten auf einem Cosmopolitan Cover zu erscheinen.
Carolin Gasteiner nennt GNTM ein „kleines Dorf sexistischer, autoritärer und renitent oberflächlicher Showmacher“ die sich von der Außenwelt und den Skandalen sexueller Belästigung, um Hollywoodproduzenten, abschotten.
Anke Schipp hat Angst, dass ihre Tochter mit dem Anschauen von GNTM falschen Rollenbildern folgt und fragt diese, ob sie den Job eines Models nicht bescheuert finde, da die Frau doch intellektuell gar nicht gefordert wird.
Ulrika Tillmann hinterfragt das „moderne Frauenbild“ von Anke Schipp und betitelt es als „keinen Tick besser als das verhasste, sexistische Medienbild.“ Frau Tillmann fragt nach einem Frauenbild, in dem jede Frau einfach so ist, wie sie sein möchte.
Friedhard Teuffel nennt die Challenge, in der Heidi Klum „ihre Kandidatinnen bei Germany´s Next Topmodell an aufgegeilten Knastdarstellern vorbeilaufen“ lässt, einen „Trauermarsch zur Beerdigung der Frauenwürde“. Wobei er Würde hier für Heidi und ihre Modells, nicht passend findet.
Hier nur ein kleiner Einblick in eine Fülle von Kommentaren zu dieser Sendung. Interessant finde ich bezüglich des Themas Gendersensibilität, dass ich überwiegend Frauen gefunden habe, die sich mit dieser Castingshow beschäftigen. Liegt dies daran, dass es um die Frauenrolle in der Gesellschaft geht und dann typisch nach dem Motto, was Menschen nicht betrifft interessiert sie nicht oder finden Männer dieses Frauenbild in Ordnung? Zu ersterem finde ich schon fast ironisch, dass sich der von mir einzige aufgezählte Mann äußert, über eine Szene in der seiner Meinung nach Männer die „rüttelnden Bewunderer“ der Models darstellen. Stört ihn vielleicht die Rolle des Mannes als unzivilisiertes Opfer seiner eigenen Triebe? Oder äußert er sich tatsächlich über die Frau als Lustobjekt? Was denkt ihr?
Im Unterricht möchte ich das Thema weder als pos. noch als neg. Beispiel verwenden. Mir liegt es sehr am Herzen, dass sich die SuS ihre eigenen Meinung über dieses Thema bilden. Ich glaube es gibt wenige Menschen die komplett zufrieden mit sich und vor allem mit ihrem Körper sind. Wie soll es dann eine Lehrkraft schaffen, dass die verschiedensten SuS sich, in einer der emotionalsten Phasen ihres Lebens, in welcher sie ihren Körper neu kennenlernen müssen, selbst komplett akzeptieren? Ich möchte ihnen kein „sei wie du bist“ um die Ohren hauen, wenn sie nicht einmal wissen wer sie denn überhaupt sind. Ich möchte nicht sagen „du kannst alles schaffen, was du dir vornimmst, wenn du nur hart genug dafür arbeitest“, wenn sie nicht wissen was sie schaffen wollen. Ich möchte hören was sie denken, ich möchte ihre Meinung verstehen.
Deshalb würde ich einen Ausschnitt der Castingshow im Unterricht zeigen. Im Anschluss sollen die SuS in Einzelarbeit 10 Minuten lang eine Mind-Map auf einem Blatt Papier erstellen. Daraufhin sollen sie diese mit ihrem Sitznachbarn austauschen und erhalten die Aufgabe alles für sie positive mit grün und alles für sie negativ klingende mit rot zu umkreisen. Nachdem die Blätter wieder zurückgetauscht sind, soll jeder SuS seine roten und seine grünen Kreise überprüfen, sind diese zwar rot umkringelt aber nicht so gemeint, wird nochmals in den Austausch mit dem Partner gegangen. Die Kreise dürfen auch von rot auf grün geändert werden. Wichtig ist mir hier nur der Austausch und das die SuS verstehen, ihre Stichpunkte sind selbst in ihrer Bedeutung subjektiv. Schlussendlich soll jeder SuS alle Stichpunkte seiner eigenen Meinung nach rot und grün umkringelt haben. Die Kreise werden nun gezählt. Es folgt die Bildung von Gruppen. Gruppen mit überwiegend positiver und Gruppen mit überwiegen negativer Meinung, je nach Klassengröße und sich ergebenden Gruppen, sollten drei bis fünf SuS zusammen ihre positiven und negativen Punkte in Gruppenarbeit vergleichen. Jede Gruppe sollte nach 30 Minuten vier ausgearbeitete Argumente für ihre überwiegende Meinung und zwei für die Gegenseite entwickelt haben. Der Ablauf ändert sich nicht, sollte die ganze Klasse überwiegend einer Seite angepasst sein. Gibt es nun nur eine Meinung in der Klasse, wird in einer Art literarisches Gespräch im Stuhlkreis übergegangen. Haben sich verschiedene Gruppen herausgebildet, werden zwei unterschiedliche nach vorne geholt und in eine Debatte über die Absetzung des Formates, geleitet. Zum Abschluss soll im Plenum reflektiert werden. Angesetzt für mindestens eine Doppelstunde.
Ich würde mich sehr über euere Meinung freuen!
Eure becomeateacherlove
_______________________________________________________________________
Gasteiner, C. (24.5.18): https://www.sueddeutsche.de/medien/finale-von-gntm-heidi-ist-der-haeuptling-im-macho-dorf-1.3991514.
Schipp, A. (22.02.18): http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/germany-s-next-topmodel-den-schrott-willst-du-gucken-15453576.html.
Tillmann, U. (28.02.2018): http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/so-frauenfeindlich-ist-germany-s-next-topmodel-wirklich-15466285.html.
Teuffel Friedhard (22.03.18): https://www.tagesspiegel.de/medien/germanys-next-topmodel-heidi-klum-beerdigt-bei-gntm-die-wuerde-im-gefaengnis/21097018.html.
1 note
·
View note
Text
Die Froschkönigin oder doch die zwölf Schwestern?
Ich habe mir gerade drei zufällige Märchen der Gebrüder Grimm durchgelesen. Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich, die zwölf Brüder und Aschenputtel.
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich
Die jüngste Königstochter ist natürlich die schönste, immerhin trauern wir ja alle der „Schönheit der Jugend“ nach. Sie ist schön, eingebildet, arrogant und auch naiv. Eigenschaften die wir wohl vielen Reichen, Jungen und Schönen zuschreiben würden. Sie verliert ihre goldene Kugel und ein ekeliger schmieriger Frosch holt sie ihr nur zurück, verspricht sie ihn an ihrer Seite leben zu lassen. Sie verspricht es, der Frosch holt die Kugel und das Mädchen geht ohne den Frosch. Das reiche und schöne Mädchen nutzt den armen ekligen Frosch aus. Der Frosch fordert das Versprechen ein und der König, ehrenhaft wie er ist, unterstützt ihn. Die arme Prinzessin weint viel, nimmt den Frosch und wirft ihn an die Wand und was passiert? Der Frosch verwandelt sich in einen wunderschönen Königssohn. Sie heiraten. Zum Schluss kommt der liebe Diener Heinrich und die unverwechselbare Männerfreundschaft blüht wieder auf. Die Prinzessin so unverschämt, reich und hübsch, bekommt ihr Happy End. Durch den Vater wird sie zu ihrem Glück gezwungen, durch den Königssohn erhält sie ihr Glück.
Männlich: nett, lieb, ehrenhaft, treu, hilfsbereit
Weiblich: hübsch, naiv, arrogant, beeinflussbar, gehorsam
Die zwölf Brüder
Zwölf Königssöhne die von ihrem Vater umgebracht werden sollen, ist das dreizehnte Kind ein Mädchen. Das Töchterlein soll den ganzen Reichtum alleine haben. Die Königin verrät den Plan des Vaters, die zwölf Buben reißen aus und warten auf das Zeichen der Mutter, in Form einer Fahne am Schlossturm, ob ein Mädchen oder Junge geboren worden ist. Natürlich wird ein Mädchen geboren und die Brüder müssen in einer verwunschenen Hütte im Wald leben. Der kleinste und schwächste soll die Hausarbeit erledigen (gilt diese Aufgabe deshalb immer der Frau?). Das erste Mädchen, welches sie treffen soll als Rache sterben. Die Königstochter wird älter und sucht, der Mutter zur Liebe, ihre Brüder. Findet das Häuschen und den kleinsten Bruder, dieser freut sich und überredet die anderen Brüder nicht das erste Mädchen zu töten, alle freuen und lieben sich. Das Mädchen bleibt bei ihren Brüdern, will ihnen einen Freude machen, pflückt zwölf Blumen und ihre Brüder verwandeln sich in Raben. Wer hat dieses Unheil angerichtet? Natürlich eine böse alte Frau. Einzige Chance, das Mädchen muss sieben Jahre schweigen und darf nicht lachen. Auf einem Baum, einsam im Wald versteckt sich das Mädchen. Ein Prinz kommt vorbei wählt sich das Mädchen als Gemahlin aus, die böse Stiefmutter redet dem armen Sohn ein, seine Gemahlin wäre böse, würde sie doch weder lachen noch sprechen. Das Mädchen soll verbrannt werden, doch ach welch Glück, die sieben Jahre sind verstrichen, die Raben kommen herbeigeflogen und verwandeln sich zurück in ihre zwölf Brüder. Das Mädchen wird erlöst und kann ihrem Gemahlen alles erzählen. Die böse Stiefmutter stirbt.
Männlich (Jungen): nett, Retter, ehrenhaft,
Männlich (Mann): böse, rücksichtslos, hinterlistig
Weiblich (Mädchen): naiv, gutmütig, fehlerhaft, hilflos
Weiblich (Frauen): böse, hinterlistig (ausgeschlossen Königin)
Aschenputtel:
Die Mutter stirb und der Vater findet eine neue Frau. Die neue Frau entpuppt sich als böse Stiefmutter und bringt zwei böse Stiefschwestern für das arme Aschenputtel mit. Aschenputtel hat an ihrer Mutter Grab, Wünsche frei. Trotz der Erfüllung der Aufgaben der Stiefmutter, durch Hilfe der lieben Tiere, darf Aschenputtel nicht mit auf den Ball des Prinzen, der eine Gemahlin sucht. Aschenputtel darf nur ihre Stiefschwestern hübsch machen. Das arme Mädchen wünscht sich schöne Kleider, geht dreimal zum Ball. Tanzt mit dem Prinzen der nur Augen für sie hat und entwischt ihm alle drei Male, als er sie nach Hause bringen will. Beim dritten Mal, verliert sie durch eine List des Prinzen einen Schuh. Der Prinz sucht Aschenputtel mit dem Schuh. Die Stiefschwestern verletzen sich um in den Schuh zu passen, die Lügen werden jedoch aufgedeckt. Unter dem Neid der Stiefmutter und der Stiefgeschwister findet der Prinz seine rechte Braut (Aschenputtel) und heiratet diese. Bei der Hochzeit werden die Stiefschwestern für ihr Verhalten durch Blindheit bis an ihr Lebensende, bestraft.
Männlich (Vater von Aschenputtel): beeinflussbar, naiv, geblendet, ehrenlos
Männlich (Prinz): hinterlistig, verliebt, ehrgeizig
Weiblich (Aschenputtel): fromm, gut, gutmütig, schlau, mutig, lieb,
Weiblich (Stiefmutter und Stiefschwester): böse, gemein, hinterlistig, neidisch, naiv, eingebildet,

Was lässt sich bei Betrachtung der männlichen und weiblichen Rollen feststellen?
Im Großen und Ganzen ist es doch immer der Prinz, der die arme Prinzessin erlöst. Der Froschkönig erlöst die Prinzessin von sich selbst, die Königstochter im zweitgenannten Märchen wird erst vom Prinzen aus ihrer Einsamkeit geholt und dann von ihren zwölf Brüdern (Prinzen) erlöst und dann Aschenputtel, die durch den Prinzen von ihrem erniedrigenden Leben unter der Stiefmutter und ihren Stiefschwestern, erlöst wird. Außerdem gibt es oft diese böse Frau. Bei Aschenputtel die Stiefmutter und zugleich noch die bösen Stiefschwestern, alle weiblich. Im Märchen der zwölf Brüder, die alte böse Frau die für die Verwandlung der Brüder verantwortlich ist und dann gibts es da die böse Hexe, die den armen Königssohn in einen Frosch verwandelt hat. Der Mann als starker Held, die Frau als arme hilflose naive Prinzessin.
Meiner Meinung nach werden hier klare Rollenbilder von den Märchen vermittelt. Nach reiflicher Überlegung finde ich, dass Märchen gerade deswegen ihre Berechtigung im Deutschunterricht haben. Die SuS werden bestimmt schon einiges über ihre „Rolle als männlicher oder weiblicher Part in der Gesellschaft“ wissen und sich auf ihre Weise Gedanken darüber gemacht haben. Ich möchte mit meinem Unterricht erreichen, dass die SuS lernen, dass jeder in verschiedenen Lebenssituationen verschiedene Rollen einnimmt. Diese Rollen sich jedoch nicht auf das Geschlecht beziehen sollten.
Dazu fände ich es schön, eine Projektwoche zum Thema „völlig von der Rolle“ mit einem abschließenden Theaterstück, umzusetzen. Innerhalb dieser Woche lernen die SuS verschiedene Märchen kennen, diese kann vielleicht auch Schulübergreifend für verschiedene Jahrgangsstufen ausfallen. Jedes „Märchen“ wird von einer Lehrkraft betreut. Die SuS setzen sich intensiv mit dem Inhalt und den verschiedenen Figuren auseinander. Ihre Aufgabe ist es das Märchen „verkehrt herum“ vorzuspielen. Die Geschlechter werden vertauscht, die Eigenschaften bleiben. Nachdem die Stücke am Ende der Woche aufgeführt wurden, soll es verschiedene Reflexionsphasen geben. Wie haben sie sich während des Spielens gefühlt? Wie war es ein solches Stück anzusehen? Welche Gefühle haben sie dabei entwickelt und was haben sie gedacht? Vielleicht sollten die Stücke auch auf zwei verschiedene Arten geprobt werden. Einmal in der vorgeschriebenen und einmal in der umgekehrten Geschlechterrolle. Daraufhin sollen die SuS selbst entscheiden welches Stück sie aufführen oder ob sie Mischen zwischen männlich in dem Märchen wird zu weiblich oder männlich in dem Märchen bleibt männlich und ebenso mit der weiblichen Rolle. Ich erhoffe mir, dass die SuS allein in der Debatte darüber, wie das Stück gespielt wird und ihrer Erfahrung mit dem Spielen selbst, bemerken wie sich das andere Geschlecht in seiner Rollenzuschreibung fühlt. Das Thema „Fairness“ kann durchaus auch eine Rolle spielen.
Ich hoffe ich konnte euch inspirieren, sagt mir doch euere Meinung in den Kommentaren.
Eure becomeateacherlove.
_______________________________________________________________________
https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/list
1 note
·
View note
Text
„Das Internet? Gibt’s diesen Blödsinn immer noch?“ - Homer Simpson
Neulich habe ich mir eine App auf mein Smartphone geladen, die trackt, wie lange ich es am Tag benutze. Ich gebe zu, es war verdammt viel Zeit, jedoch war ich nicht überrascht. Im Schnitt ist mein Smartphonebildschirm 5 Stunden und 43 Minuten am Tag an und ich entsperre es 99-mal am Tag. Jetzt könnte ich natürlich lügen und behaupten, dass liegt daran, dass ich so wahnsinnig viel Nachrichten den ganzen Tag über lese, ich jederzeit checken muss wie der DAX gerade steht oder ich heimlich eine wahnsinnig erfolfreiche Influencerin bin, die den ganzen Tag per Smartphone mit ihrer Community in contact stayen muss.
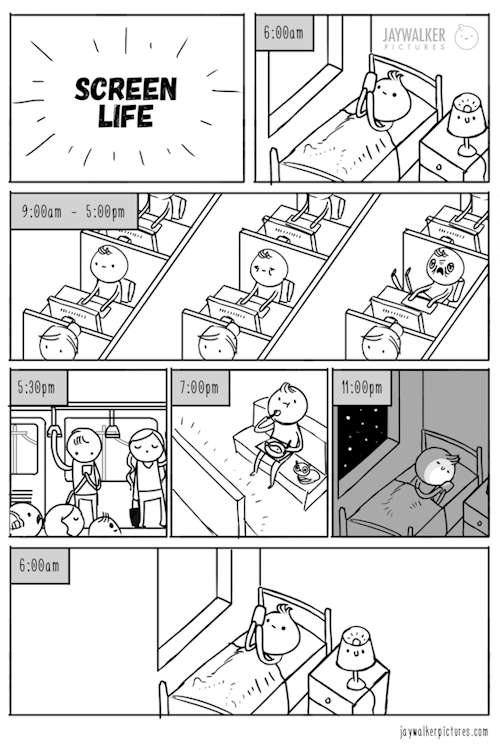
Aber das wäre alles Quatsch. Ich bin ehrlich. Es ist Gewohnheit, die mich am Tag 99-mal mein Smartphone checken lässt. IPhone aus der Tasche ziehen - sehen, dass es eigentlich keine neuen Nachrichten an mich gibt - trotzdem entsperren - kurz in Facebook - kurz in Instagram - raus aus Instagram - aaah nochmal ganz kurz in Instagram - oh Gott was hat die denn wieder gepostet? - okay jetzt aber weg mit dem Smartphone - ping - meine beste Freundin schickt mir ein Bild von ihrem Frühstück per Snapchat - ich schick ihr ein Bild von meinem Kaffee zurück - jetzt aber weg mit dem Handy - ich schlage die Zeitung auf.
Ja gut. Ich schlage nicht die Zeitung auf…ich öffne eine von fünf Nachrichtenapps auf meinem Smartphone.
Naja und so geht das eben jeden Morgen. Das Smartphone ist mein Start in den Tag. Und man würde die Augen vor der Wahrheit verschließen, wenn man glaubt, bei Schülerinnen und Schülern würde das vor der Schule anders aussehen. Oder nach der Schule…oder auch in der Schule.
Facebook ist für sie zwar nicht mehr cool, schließlich sind da mittlerweile die Eltern oder sogar Großeltern angemeldet, aber Instagram bzw. einfach Insta, das ist noch eine elternfreie Plattform. Und da wird sich zu Hauf getümmelt und vor allem konsumiert. Stundenlang werden sich die Storys von Influencern angeschaut, in denen sie zum einem von ihrem Tag erzählen und zum anderen anpreisen, was man alles tolles kaufen kann, um so wie sie zu sein. “ Meist haben Influencer ein paar tausend Follower bis hin zu einem Millionenpublikum. Die wohl bekanntesten Influencer sind auf den Sozialen Netzwerken YouTube und Instagram aktiv. Hier stellen sie hauptsächlich ihr Leben dar: Hobbies, ihren Lifestyle, ihre Lieblingsprodukte oder ihre eigene Meinung. Dabei gibt es Blogger zu beinahe jedem Thema” (Landesmedienzentrum Baden-Württemberg). Das Thema Influencer kann man gut mit der Behandlung des Themas Werbung verknüpfen um die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Schließlich haben sich in den vergangenen Jahren große Influencer-, Youtube- und Bloggeraccounts immer mehr zu Dauerwerbesendungen gewandelt. “ Der Bereich des Influencer-Marketings kann inzwischen schon als ein eigenes Berufsfeld beschrieben werden. Was für die meisten Internetberühmtheiten als Hobby begann, beschert ihnen heute zu Teilen ihr Einkommen: Zu Beginn zeigten Influencer wohl wirklich ihre Lieblingsprodukte und ihren Lebensstil, bis die Unternehmen auf sie aufmerksam wurden. Diese schickten Geschenke, eigene Produkte, die den Followern dann beispielsweise in Beauty-Videos vorgestellt wurden” (Landesmedienzentrum Baden-Württemberg). Im Gegensatz zum Fernsehen, wo meist sehr deutlich ist, wann gerade Werbung gesendet wird und wann nicht, verwischen auf diesen Plattformen immer mehr die Grenzen zwischen Werbung und persönlicher Empfehlung. Für den Unterricht wäre es hier also interessant die Kinder einen solchen Account analysieren zu lassen. Die Plattform kann hierbei selbst gewählt werden. Welche Accounts zur Auswahl stehen, sollte die Lehrkraft entscheiden, jedoch sollten die Schülerinnen und Schüler in den Entscheidungsprozess miteinbezogen werden. Nun kann man diese Accounts unter verschiednene Aspekten beleuchten (nur Vorschläge):
Welche Zielgruppe wird angesprochen?
Auf welche Weise wird Werbung gemacht?
Wie häufig wird Werbung geschalten?
Ist die Werbung leicht zu erkennen oder ist sie eher versteckt?
Folgst du dem Influencer/Youtuber/Blogger gerne?
Was spricht dich am meisten an?
Siehst du Probleme augrund der Art und Weise oder Häufigkeit mit der die Werbung geschalten wird?
Um das Thema zu vertiefen, könnte man die Ergebnisse mit “herkömmlicher” Werbung in Printmedien und Fernsehen vergleichen.
Zum Fachprofil Deutsch gehört unter anderem auch die eigene Mediennutzung zu reflektieren. Dies könnte auch im Rahmen dieses Themas geschehen, zum Beispiel durch ein Tagebuch in welchem festgehalten wird, welches Medium man wie häufig in der Woche nutzt und für was man es nutzt. Ziel ist vorrangig die kritische Auseinandersetzung mit den Medien mit besonderem Bezug zur Werbung und auch dem Internet. Denn gegen aller Erwartungen hat sich dieses vermaledeite Internet eben doch durchgesetzt und obwohl es das jetzt schon ziemlich lange gibt, wissen immer noch viele gar nicht so richtig damit umzugehen. Wahrscheinlich wissen da die Schülerinnen und Schüler oft mehr als ältere Semester, jedoch fehlt ihnen vermutlich oft die nötige Verantwortung und der Weitblick um damit vernünftig und sicher umzugehen. Hier sollte man also Unterstützung leisten.
Wie seht ihr das? Gehören Influencer in den Unterricht? Schreibt mir gerne einen Kommentar!
Eure teachingpapaya

Verwendete Quellen:
Landensmedienzentrum Baden-Württemberg : Influencer: Lang unerkanntes Werbepotenzial
Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München: Fachprofil Deutsch
8 notes
·
View notes
Text
...und noch eine Prise Gendersensibilität.
Es ist schon ironisch. Vor kurzem saß ich noch an einer Hausarbeit für mein Studium. Lehrstuhl: Soziologie; Thema: Geschlechtergerechtigkeit am Arbeitsmarkt. Und wie sich das als Vorzeigestudentin gehört, lief natürlich der Fernsehen. Was ich angesehen habe? Natürlich die WM! Irgendein X-beliebiges Gruppenspiel lief, vermutlich war es immer noch gehaltvoller als alles, was die deutsche Nationalmannschaft dieses Jahr zustande gebracht hat. Aber gut darum soll es jetzt nicht gehen. Es lief also ein WM-Spiel. Kommentiert von Claudia Neumann. Ja gibt es denn sowas? Eine Frau kommentiert Männerfußball! Welch Skandal! Ich sah es förmlich vor mir, wie den Frauen-gehören-an-den-Herd-Verfechtern ihr Feierabendbier aus der Hand glitt, geschockt von dieser Wendung in ihrem schönen Männerfußball. Einer kurzer Blick auf Facebook, Twitter und Co. genügte, um es zu sehen. Die Frauen-sind-reine-Babylegemaschinen-Fraktion haute in die Tasten: “Was soll das? Frauen gehören in die Küche und nicht ins Fußballstadion!” - “Ich hab ja nichts dagegen, wenn Frauen arbeiten gehen, aber mein Fußball sollen die nicht kommentieren.” - “Also Frauenfußball kann sie meinetwegen kommentieren, das schaut sich ja eh keiner an haha”

Wow! Da sitze ich nun. Schreibe darüber, wie hoch die Geschlechterungleichheit am Arbeitsmarkt noch immer ist und lese parallel solche Aussagen. Da fragt man sich schon, ob die aktuellen Genderdebatten, die Fragen ob es nun die Studenten, die Studentinnen oder doch die Studierenden sind, nicht doch mehr Berechtigung haben, als ich es bisher angenommen hatte.
Bisher hatte ich das alles eher belächelt, doch vielleicht wäre es doch angebracht ein wenig mehr zu Gendern. Sowohl im Alltag, als auch im Unterricht. Doch wie setzt man das im Unterricht um?
Ich versuche mich mal an einem kleinen Leitfaden zu gendersensibler Didaktik, basierend auf einem Votrag von Prof. Dr. Hildegard Macha:
Unter geschlechtssensibler Didaktik versteht man zunächst erst mal keine wirklich “neue Didaktik”, sondern dass man didaktische Prinzipien unter dem Genderaspekt betrachtet und auch modifiziert. Wie eben bereits erwähnt beginnt dies bereits schon bei der Sprache. Hier gilt es diese mit dem Bewusstsein darauf anzuwenden, dass Sprache und Kommunikationsmittel das eine oder das andere Geschlecht diskriminieren können. Zusätzlich sollte man sich auch seiner eigenen Geschlechterrolle als Lehrende oder Lehrender bewusst sein und diese gegebenfalls reflektieren und bei der Unterrichtsplanung mit einbeziehen. Geschlechtssensible Didaktik umfasst verschiedenste Aspekte im Unterricht: die Vorbereitung der Lerninhalte, die Erstellung der Lernunterlagen, die Auswahl der Lernmethoden, eine geschlechtergerechte Sprache, geschlechtergerechte Kommunikationsstile und Gesprächsverhalten und auch eine gendersensible Analyse von Lehrmaterialien, Texten und Bildern.
Möchte man also auf eine gendergerechte Sprache in seinem Unterricht zurückgreifen, sollte man auf folgendes achten:
man sollte das Geschlecht sichtbar machen, bspw. durch das aktive Nutzen von Artikeln, Attributen und Endsilben oder das Nutzen von Sonderformen (Hebamme - Entbindungspfleger)
Infantilisierungen sollten vermieden werden (”die Skihasen”)
ebenfalls vermieden werden sollten geschlechtlich konnotierte Aussagen (”Pantofflheld”, “Heulsuse”)
Auf Kongruenz sollte geachtet werden
zudem sollte man bei Liedern und Reimen vorsichtig sein (”spanenlanger Hansel, nudeldicker Dirn”)
Möchte man zusätzlich auch seine Lehrmaterialien, Texte und Bilder auf Herz und Nieren prüfen, eignen sich folgende Fragestellungen:
Wie oft kommen die verschiedenen Geschlechter in Text und Bild vor?
Werden Frauen (bspw. durch entsprechende Bezeichnungen) sichtbar gemacht?
Sind die Darstellungen realitätsbezogen? (Werden alte Rollenbilder dargestellt?)
Werden sowohl erfolgreiche Männer, als auch erfolgreiche Frauen dargestellt?
Werden Frauen und Männer gleichermaßen mit Erfindungen, Kunstwerken, Professionen in Verbindung gebracht?
Mit Blick auf den Deutschunterricht sollte man sich diese Frage vermutlich vor allem bei der Frage der richtigen Klassenlektüre stellen. So kann vermieden werden, dass ein Geschlecht thematisch außenvor bleibt oder eventuell sogar benachteiligt in der Lektüre wegkommt.
Hat euch meine Übersicht geholfen? Was denkt ihr über das Thema geschlechtergerechter Unterricht? Ab mit euren Gedanken in die Kommentare!
Eure teachingpapaya.
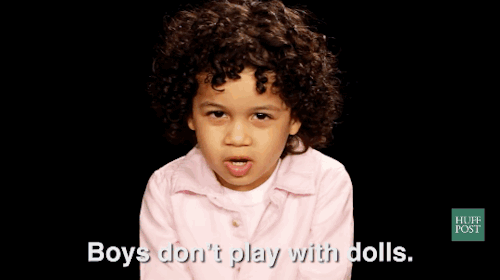
Verwendete Quellen und Literatur:
Macha, H.: Geschlechterbewusst unterrichten - Forschungsstand und Umsetzung. Genderzentrum Augsburg 2011
8 notes
·
View notes
Text
Germany’s next Topmodel im Deutschunterricht?
Wer kennt es nicht: Die neue Staffel GNTM läuft an, man trifft sich gemeinsam zu Chips und Wein und schwankt den ganzen Abend zwischen Mitgefühl und Herziehen über die Gestalten auf dem Fernsehbildschirm. Mädchen, deren großer Traum es ist, Model zu werden. Mädchen, die als Fernsehstars berühmt werden wollen und in einer Castingshow die erste Sprosse ihrer Karriereleiter emporsteigen wollen. Mädchen, die im Alter von 16 vielleicht noch gar nicht beurteilen können, auf was sie sich denn da gerade einlassen.
Aber halt: Seit 2015 gibt es bereits drei Teilnehmerinnen, die sich einer Geschlechtsumwandlung zur Frau unterzogen haben. War es für Heidi Klum anfangs weniger prickelnd, dass sich nicht nur „Meedchen“ bewerben (https://bit.ly/2KhABkG - Stern-Artikel von 03/15), wird es langsam selbstverständlich, dass Transgender an GNTM teilnehmen „dürfen“.
Umso interessanter ist es, hier anzusetzen, um mit SchülerInnen und Schülern (SuS) über die Sendung und die Art, wie die überhaupt funktionieren kann, zu diskutieren. Warum aber gerade im Deutschunterricht? Die Begründung findet sich zum einen in der Textform. Denn Deutschunterricht arbeitet nicht nur mit dem (noch) Leitmedium Buch, sondern auch mit audiovisuellen Texten. Zum anderen bietet der identitätsorientierte Deutschunterricht nach Frederking hier einen Handlungsrahmen. Der Ansatz besagt, dass Deutschunterricht Jugendlichen den „Raum […] für den Aufbau eines individuell tragfähigen Selbst- und Wirklichkeitsverhältnisses in einer individualisierten und enttraditionalisierten Lebenswirklichkeit“ geben kann (Frederking 2001, S. 95). Hierunter fällt auch der Aspekt geschlechtlicher Identität. Frederking argumentiert, dass ein identitätsorientierter Unterricht besonders für Jugendliche in der Pubertät, die auf der Suche nach (Rollen-)Vorbildern sind, „beim Aufbau einer selbstbewussten geschlechtlichen Identität“ (Frederking 2010, S. 430) unterstützend sein kann. Im Konkreten bietet dieser Ansatz also einen Handlungsrahmen, um gezielt Rollenbilder zu identifizieren und Stereotype dekonstruieren zu können – und so SuS in ihrem Rollenverständnis und bei ihrer Entwicklung zu unterstützen.
Eine Unterrichtssequenz würde ich mithilfe des verlinkten Videoclips, der aufgeteilt in drei Abschnitte angesehen werden soll, gestalten:
youtube
Abschnitt 1 und 2: 0:00-01-15min, 3:45-4:57min
Zuerst soll betrachtet werden, wie Dennis sich vorstellt. Dabei sollen folgende Fragen im Vordergrund stehen:
Warum nimmt er an GNTM teil? Was ist seine Botschaft?
Was kritisieren oder bewundern die Mädchen an ihm?
Was macht ihn anders als andere TeilnehmerInnen bei GNTM oder sogar anders als andere junge Männer?
Die SuS können sich Stichpunkte aufschreiben und anschließend an der Tafel ihre Beobachtungen sammeln.
Abschnitt 3: 01:16-3:44min
Anschließend wird sich der zweieinhalbminütige Abschnitt über Cecilia angesehen und ihre Verhaltensweise analysiert. Hier sollen folgende Fragen Beachtung finden:
Ist Cecilia für dich die „klassische“ Teilnehmerin bei GNTM? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
Was an ihr ist „typisch Frau“?
Was erzählt sie über ihr Verhalten?
Auch die Ergebnisse zu diesen Fragen werden gemeinsam an der Tafel gesammelt. Nachdem alle Ergebnisse gesammelt sind, folgt eine Diskussion. Es soll herausgefunden, ob Dennis sich rollenspezifisch verhält, und ob sein Verhalten dem von Cecilia ähnelt. Schließlich trägt er eine Perücke, schminkt sich, redet ein wenig höher, hat eine sehr weibliche Figur. Cecilia selbst ist geschminkt (starkes Rouge), zickt ihre Mutter an und verkörpert doch ein wenig das, was wir als Bild des klassischen pubertierenden Mädchens im Kopf haben.
Abschnitt 4: 04:58-Ende
Nach der Diskussion wird der Rest des Clips angesehen, in dem Wolfgang Joop unter anderem betont, dass das Wort „Model“ per se nicht an ein Geschlecht gebunden ist und dass es völlig okay ist, auch als androgyner Mensch oder als Transgender zu modeln. (Selbstverständlich würde Heidi Klums Verhalten im Kontrast zu Wolfgang Joops Offenheit hier auch Raum für eine Diskussion bieten. Dies würde meiner Meinung nach aber den Rahmen sprengen.) Ziel der Diskussion und Unterrichtssequenz soll es sein, dass die klassischen Rollenbilder und damit einhergehende Verhaltensmuster anhand der Castingshow Germany’s Next Topmodel entdeckt und dekonstruiert werden – und dass die SuS realisieren, dass sie in ihrer Rollenentwicklung frei sind und sich nicht an alte, tradierte Formen halten müssen.
Liebe Leser, wie steht ihr dazu? Haltet ihr die Fragen für geeignet? Würdet ihr komplett anders vorgehen? Über euer Feedback freue ich mich.
_________________________
Literatur:
Frederking, Volker: Peter Härtlings ‚Ben liebt Anna’ - Identitätsorientierter Umgang mit einem Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur im Zeichen von Individualisierung, Pluralisierung und Medialisierung. In: Christine Köppert / Klaus Metzger (Hrsg.): „Entfaltung innerer Kräfte“. Blickpunkte der Deutschdidaktik. Festschrift für Kaspar H. Spinner anlässlich seines 60. Geburtstages. Seelze: Friedrich, S. 92-109
Frederking, Volker ; Krommer, Axel ; Meier, Christel (Hrsg.) : Literatur- und Mediendidaktik. Bd. 2, 1. Aufl. Baltmannsweiler : Schneider, 2010, (Taschenbuch des Deutschunterrichts), S. 414-451.
10 notes
·
View notes
Text
Schneewittchen ohne 7 Zwerge
Denkt man an Märchen, assoziiert man diese sofort mit bestimmten Dinge. Es gibt die schöne Prinzessin, den tapferen Prinzen, die böse Stiefmutter und natürlich trotz aller Bösewichte immer ein Happy End.
In wahrscheinlich jedem Haushalt findet sich ein Märchenbuch und wenn es in der hintersten Regalecke verstaubt. Es ist da. Zum Einschlafen wird den Kindern daraus vorgelesen. Doch wenn das Kind dir am nächsten Tag von einer verrückten Sache berichtet, soll es dir doch bitte „kein Märchen erzählen!“ Gleichzeitig wünschen sich aber alle doch immer eine Märchenhochzeit. Alles traumhaft, alles perfekt und ohne böse Stief…Schwiegermutter bitte. Junge Mädchen sitzen mit verträumtem Blick an Fenstern und warten darauf, dass ihre Prinzen auf einem hohen Ross oder zumindest einem kleinen Mopped kommen, um sie abzuholen. Und die Jungen? Die finden in dem neuen Kleid sehen ihre Freundinnen wirklich wie Prinzessinnen aus.

Märchen sind so oft etwas Alltägliches. Sie dienen als Vorlagen für ausgedachte Geschichten, sind Themen für Mottopartys oder Namensgeber für bunte Tortenkreationen. Eine „verzauberte Dornröschentorte“ verkauft sich einfach besser, als eine „rosa Zuckerbombe mit fünf Erdbeeren oben drauf, von denen eine matschig ist“. Doch nicht nur für das Genannte stehen Märchen Pate. Sie erzählen vor allem von Wünschen. Setzt man die Märchen in ihren zeitlichen Kontext, “so zeigen [sie] in Grenzen auch, wie es Menschen ‘äußerlich’ erging, mehr als das aber zeigen Märchen, was in ihnen vorging, was sie fürchteten und vor allem, was sie sich wünschten, hofften, ersehnten, obwohl, ja gerade weil es noch keinen Ort hatte, utopisch war” (Dickerhoff 2009, S.96). So wie die Wünsche in den historischen Kontext gesetzt werden können, ist es auch mit dem Geschlecht. Damals gängige Geschlechterklischees werden häufig, insbesondere in den “Schwankmärchen” aufgegriffen und dies unter anderem auch auf diskriminierende Art und Weise. Zaubermärchen überwinden diese Klischees jedoch meist. “Hier siegt die Liebe über die Gesellschaftsordnung, hier sind auch Mädchen und Frauen stark und auf eigenen Wegen - und das in den europäischen Varianten der Grimmschen Märchen oft noch deutlicher als in den nicht selten biedermeierlich-patriacharlisch überformten Märchenfassungen der Brüder Grimm” (Dickerhoff 2009, S.98).
Hier könnte man auch für den Unterricht ansetzen und zwei Märchenfassungen miteinander Vergleichen. Als Beispiel dienen hier “Schneewittchen” und die schottische Variante “Goldbaum und Silberbaum".
Die Märchen sollen mit Blick auf die Frauenrollen gelesen werden. Während dem Lesen können bereits Auffälligkeiten notiert werden. Bei Schneewittchen gibt es nur zwei Frauenrollen. Die der bösen Königin, die zwar weiß was sie will und zielstrebig handelt, dabei aber abgrundtief böse, gefährlich und von Neid erfüllt ist und die des lieben, schönen aber recht naiven und unfähigen Schneewittchens, das ohne männliche Hilfe und Rettung nicht durchs Leben kommt. Obendrein wird ihr der Schutz nur dann garantiert, wenn sie im Gegenzug die “brave Hausfrau” für die Zwerge spielt. Ihre Rettung besteht darin, dass der Prinz imgrunde nur “zu doof zum laufen” ist und stolpert. Bei der schottischen Fassung hingegen Regeln die Frauen ihren Konflikt unter sich, die Männer sind hier außen vor und meist gar nicht anwesend, falls sie zur Rettung hätten beitragen können. Zudem wird mit der zweiten Frau des Prinzen eine neue dritte Frauenrolle eingeführt: zielstrebig, mutig, klug, neidlos. Sie rettet nicht nur ihre Vorgängerin, indem sie die verschlossene Tür öffnet und die giftige Nadel entfernt, sie ist auch bereit zu Gunsten der ersten Gattin des Prinzen zu gehen. Aber sie ist auch gewillt zu bleiben und ihr dabei zu helfen der bösen Mutter mutig gegenüber zu treten und ist dann auch die, die den entscheidenter Schubser wagt um zu siegen.
Nach der Analyse der Frauenfiguren soll mit den Schülerinnen und Schülern eine Diskussion stattfinden in der folgende Fragen behandelt werden:
◉ Welches Märchen hat dir besser gefallen und warum?
◉Welche Figur fandest du am interessantesten und was ist an dieser Figur für dich interessant?
◉Mit welcher Figur könntest du am ehesten befreundet sein? Begründe!
◉ Welche Figur würde sich in unserer heutigen Zeit wohl am ehesten zurecht finden und warum?
Als Hilfestellung können diese Fragen zuerst auf einem Blatt schriftlich beantwortet werden.
Ziel ist es, dass die Kinder die Möglichkeit der verschiedenen Varianten des Märchens kennenlernen und sich mit ihnen auseinandersetzen. Zudem sollen im Lauf der Diskussion die vorhandenen bzw. eben nicht vorhandenen Rollenklischees aufgegriffen und thematisiert werden.
Schreibt mir gerne eure Gedanken zu meiner kleinen Unterrichtsidee in die Kommentare. Für Vorschläge und Verbesserungen bin ich jederzeit offen.
Eure teachingpapaya.

verwendete Literatur und Quellen:
Onlineversion von Schneewittchen der Gebrüder Grimm auf grimmstories.com
Dickerhoff, H.: Goldbaum und Silberbaum. In: Dickerhoff, H. (Hrsg.): Keltische Märchen zum Erzählen und Vorlesen. Kiel 2015
Dickerhoff, H.: Mann und Frau im Märchen - Märchen für Männer und Frauen. Die Geschlechter als Symbol in und Adressaten von Märchen. In: Arend, H./Barz,A.: Märchen - Kunst oder Pädagogik? Baltmannsweiler 2009
5 notes
·
View notes
Text
Eine Eiskönigin im Deutschunterricht.
Die Eiskönigin ist ein Produkt der Walt-Disney-Company und erzählt die Geschichte der Schneekönigin von Hans Christian Andersen neu. Mit dem knacken der 1-Milliarde-US-Dollar Marke, im März 2014, reihte sich der Film zu den erfolgreichsten animierten Filmen aller Zeiten ein.
Die Hauptcharaktere zwei junge Frauen (Elsa und Anna) begleitet von zwei Männern (Hans und Kristoff), einem Schneemann (Olaf) und einem Elch (Sven).
Von Schneewittchen über Ariell bis hin zu Elsa, der Eiskönigin und ihrer Schwester Anna, formt Disney seine weiblichen Figuren den gesellschaftlichen Stereotypen und Vorurteilen entsprechend. So spielt Romantik stetig eine wichtige Rolle und die Frauen werden eindimensional dargestellt. Definiert durch romantische oder mütterliche Liebe spielen sie oft die unterwürfige Rolle, selbst als Heldinnen sind sie passiv. Ihren Erfolg können sie lediglich durch gesellschaftliche Stellung und Attraktivität begründen und wenn sie dennoch stark und unabhängig sind, finden sie ihr Glück nur mit einem Mann an ihrer Seite.
Die männliche Rolle hingegen zeichnet sich in Disney Filmen oft als Held ab, dessen Bestreben etwas mit romantischer Liebe zu tun hat. Diese ist jedoch nicht zentral. Der Held sucht nach sich selbst und ist aktiv, er gewinnt nicht nur, weil er gut aussieht, sondern weil er etwas dafür tut. Einzig das wichtige äußerliche Erscheinungsbild stellt eine Gemeinsamkeit zu der weiblichen Rolle dar.
Davon ausgehend stellt sich die Frage inwiefern Disney Filme ihre Berechtigung im Deutschunterricht haben. Thematisiert werden kann meines Erachtens nach die Form der Geschwisterliebe zwischen Anna und Elsa. In einer Sequenz gesehen, bietet sich die erste Einheit an, um mithilfe von Mind Mapping und verschiedenen Gedankenexperimenten die unterschiedlichen Arten von Liebe, mit den Schülerinnen und Schülern (SuS), zu erarbeiten. Im Anschluss können die SuS den Auftrag erhalten sich Notizen, auf einem vorgefertigtem Arbeitsblatt, über die verschiedene Arten von Liebe im Film zu machen, während dieser im Unterricht gezeigt wird. Die Szene um Minute 43 herum, als Anna vor dem Eisschloss steht kann genutzt werden um die SuS die Gedanken und Gefühle von Anna verschritlichen zu lassen. Auch kann diese getrennt zwischen Mädchen und Jungen verlaufen, so können die Jungen die Gedanken von Kristoff niederschreiben, als dieser nicht mit in das Schloss gehen darf.
Ich glaube mit diesem Film kann viel in Richtung Identitätsorientierung gearbeitet werden. Doch ist es gut SuS in derartige Rollenfiguren hineinversetzen zu lassen?
Ich persönlich finde es gut mit dem Film der Eiskönigin im Unterricht zu arbeiten. Ich glaube dieses Thema wirkt sehr motivierend auf die SuS und lässt sie ihre eigenen Gefühle zu Personen, vielleicht gerade zu Familienmitglieder neu überdenken. Der Unterschiede zwischen Hans, der Anna äußerlich sofort in seinen Bann zieht und Kristoff den sie nur wenig Beachtung schenk und die Erkenntnis, dass Charakter mehr Wert ist wie das äußerliche Erscheinungsbild, kann gerade Jungs in ihrem Selbstbild stärken. Auch bei den Frauen wird gezeigt, dass jeder einmal Hilfe braucht. So bekommt auch Anna die kleine behütete Schwester die Chance ihrer großen starken Schwester zu helfen. Hier erhalten auch die Schülerinnen die Chance sich mit der Rolle zu identifizieren und ihr Selbstbild zu stärken.
Interessante Texte zu diesem Thema:
H. Heidemann (1998): Herrscher des Waldes und König der Löwen. Die Märchenfilme der Walt-Disney-Company. Verfügbar unter: http://www.ifak-kindermedien.de/publikationen/ifak/pdfs/disney.pdf
D. E. England, L. Descartes, M. A. Collier-Meek (2011): Gender Role Portrayal and the Disney Princesses.
Ich würde mich freuen eure Meinung in den Kommentaren zu lesen.
Eure becomeateacherlove

11 notes
·
View notes